Eine der bekanntesten Kompositionen Ludwig van Beethovens heißt „Die Wut über den verlorenen Groschen“. Experten bezweifeln die Echtheit des Titels, hinterließ Beethoven doch bei seinem Tod sieben Aktien im Wert von jeweils eintausend Gulden. Warum hätte er sich da über einen verlorenen Groschen ärgern sollen? Zwei seiner Aktien sind derzeit in der Beethoven-Ausstellung der Bundeskunsthalle zu sehen, wo der Besucher darüber hinaus Gelegenheit hat, von einem Block Beethovens Lieblingsrezept abzureißen und nach Hause mitzunehmen, um es bei Verlangen nachzukochen: Brotsuppe.
Vor einigen Jahren schon lud die Familienbildungsstätte des Bonner Beethovenhauses zu lehrreichen, nahrhaften Abenden unter dem Motto „Beethovens Kocherey“. Noch etwas länger ist es her, dass der Kulturphilosoph George Steiner scharfsinnige Überlegungen zu „Real Presences“ anstellte. Wo aber befindet sich die Realpräsenz eines musikalischen Kunstwerks? Die Realpräsenz, Sie werden sich erinnern, ist das, was Katholiken und übrigens auch Lutheraner von reformierten Protestanten trennt: Ist das Brot wie der Herr, ist das Brot der Herr, wenn man das Brot isst? Oder eben die Brotsuppe.
Herr van Beethoven war in seinen späten Jahren ein leutseliger Gastgeber, kochte selbst den Kaffee und erläuterte gern die Funktionsweise seiner Kaffeemaschine. Etwas anderes als Kaffee konnte er nicht kochen. Als er es trotzdem versuchte, misslang ihm dies wie die Reprise in der Eroica. Die Gäste baten verlegen um belegte Brote. Immerhin, sie wurden nicht mit Eiern beworfen wie Beethovens Köchin, wenn der Meister wütend war. Die neuere Forschung geht deshalb davon aus, dass die eingangs erwähnte Komposition in Wirklichkeit „Die Wut über die verlorenen Eier“ hieß.
Ute Harbusch

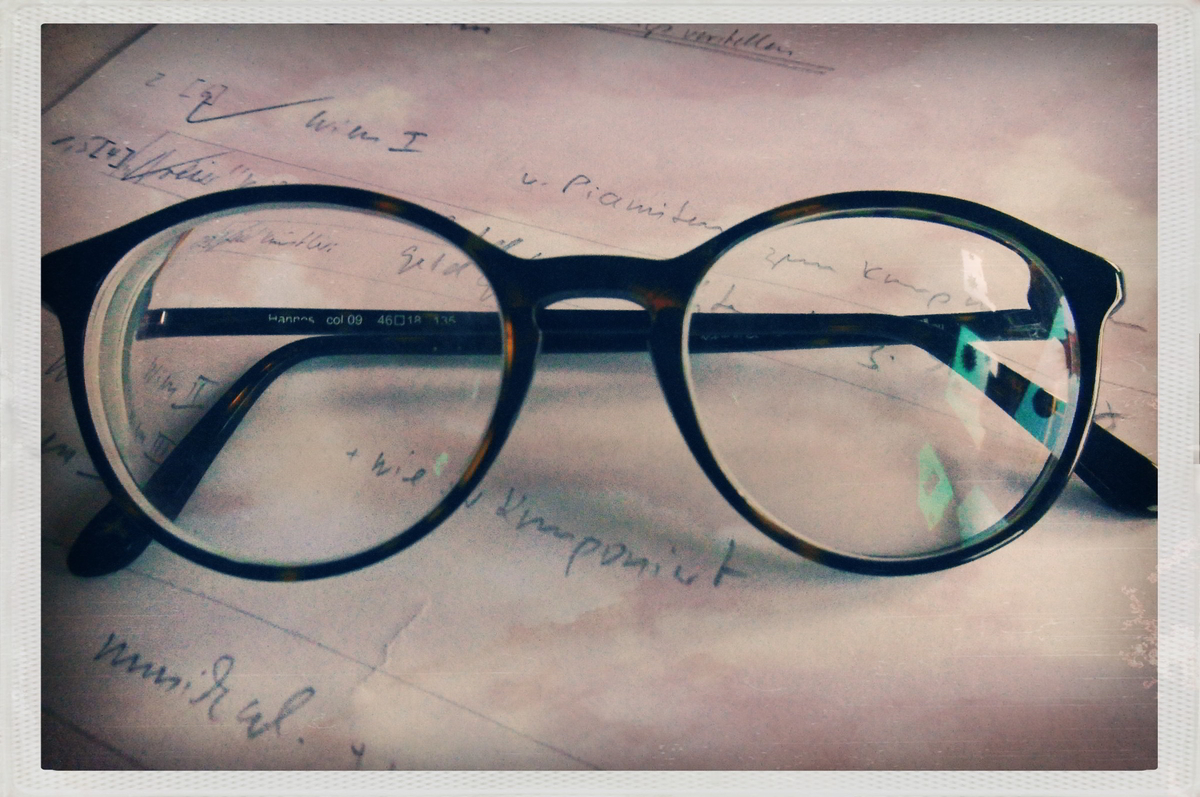
Schreiben Sie einen Kommentar